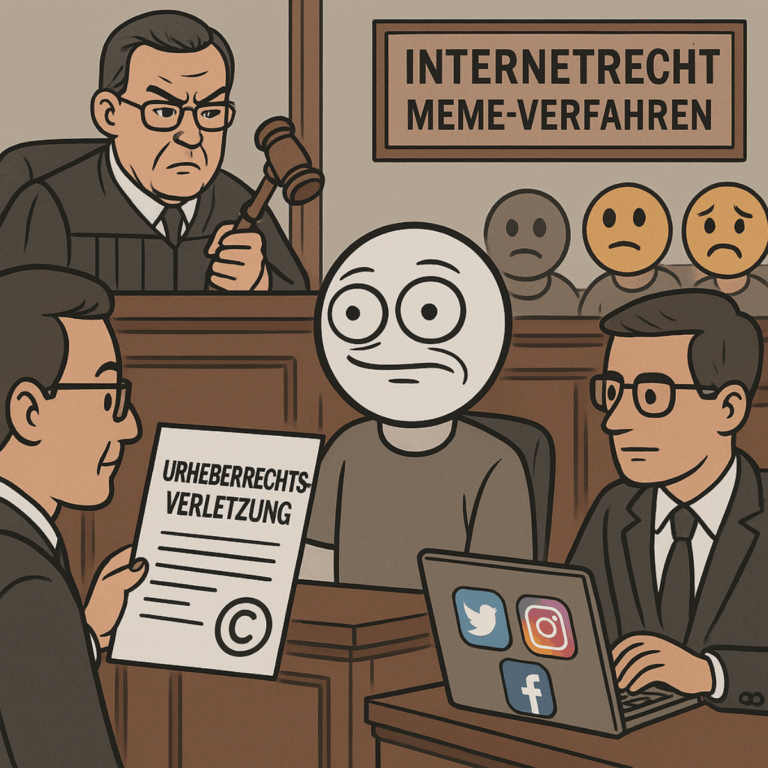„Conni“, die beliebte Kinderbuchfigur, erscheint plötzlich in Social-Media-Memes, aber auch in Werbekampagnen. Hierbei wird sie zur unfreiwilligen Protagonistin in Neuschöpfungen wie „Conni klaut beim Discounter“, „Conni leugnet den Klimawandel“ oder „Conni kriegt eine Abmahnung wegen „Conni“-Memes“. Für Unternehmen gilt: Die Nutzung der Figur birgt juristische Fallstricke – besonders im Urheberrecht.
Phänomen „Conni“-Memes – von Kinderbuch zur Popkulturfigur
Die Figur „Conni“ stammt aus der gleichnamigen Kinderbuchreihe, die seit den 1990er Jahren im Carlsen Verlag erscheint. In über 100 Bänden wächst „Conni“ mit den jungen Lesern mit – vom Kindergarten bis zum Erwachsenwerden. Sie ist freundlich, pragmatisch, blond, trägt ein rot-weiß gestreiftes Ringelshirt und einen Pferdeschwanz mit roter Schleife.
Eben diese Merkmale sind es, die aktuell von Memes in sozialen Medien aufgegriffen werden: Meist wird ein KI-generiertes Bild im vertrauten „Conni“-Stil mit einem unerwartet ernsten, politischen oder ironischen Text kombiniert. Dabei wird kein Originalbild verwendet, sondern ein vollständig neu generiertes Bild, das den Eindruck einer typischen „Conni“-Illustration vermittelt.
KI-generierte Memes als „freie Benutzungen“?
Nachdem viele „Conni“-Memes technisch neu und durch KI erzeugt sind, liegt auf den ersten Blick nahe, dass es sich bei den KI-Überarbeitungen um nicht zustimmungsbedürftige, „freie Benutzungen“ des geschützten Werkes handelt. Freie Benutzungen, hinter denen das Original „verblasst“ ist, wären frei verwendbar. Juristisch ist das neue „Werk“ als KI-Produkt mangels persönlich geistiger Schöpfung und trotz hinreichenden Abstandes zum Original allerdings kein neu geschaffenes „Werk“ im Sinne einer freien Benutzung. Dies führt auch bei einem großen Abstand zur Originaldarstellung dazu, dass bei Verwendung in der Öffentlichkeit eine nicht gerechtfertigte Urheberrechtsverletzung vorläge. Details zur spezifischen Art der Verletzung sind juristisch noch umstritten.
Urheberrechtlicher Schutz für „Conni“
Eine zustimmungsbedürftige Bearbeitung liegt allerdings auch dann vor, wenn das charakteristische Erscheinungsbild eines Schutzobjekts übernommen wird. Der Bundesgerichtshof hat im Fall „Pippi Langstrumpf“ (BGH, Urteil vom 17.7.2013 – I ZR 52/12) entschieden, dass auch literarische Figuren mit eigenständigem, prägnantem Erscheinungsbild urheberrechtlicher Schutz zukommen kann – selbst wenn die szenische Darstellung im Originalwerk nicht enthalten ist. Somit wäre die Verwendung dieser Figur eine Urheberrechtsverletzung.
Ob „Conni“ einen vergleichbaren Schutz für sich beanspruchen kann, ist bisher nicht geklärt. Wäre dem so, könnte die Übernahme des Erscheinungsbildes urheberrechtsverletzend sein.
Kunstfreiheit als Schrankenregelungen
Seit 2021 erlaubt § 51a UrhG jedoch die Nutzung geschützter Werke in Parodie, Karikatur oder Pastiche. Viele „Conni“-Memes bedienen sich karikaturistischer Umgestaltung, sodass die Nutzung von „Conni“ in solchen Fällen erlaubt wäre – sofern die Interessen des Urhebers nicht unangemessen missachtet wären. Allerdings ist bisher gerichtlich nicht allgemeingültig geklärt, wie weit diese Erlaubnis reicht.
Diese Rechtfertigung greift jedoch jedenfalls nur für die künstlerische Nutzung als Parodie, Karikatur oder Pastiche und nicht im kommerziellen Kontext. Sobald Unternehmen oder Parteien die Memes für Werbung oder Kampagnen nutzen, wäre eine Lizenz erforderlich.
„Conni“ als eingetragene Marke
Zudem ist „Conni“ zugunsten der Carlsen Verlag GmbH europaweit als Marke geschützt. Die markenmäßige Nutzung des Kennzeichens „Conni“ wäre für die eingetragenen und ähnliche Waren und Dienstleistungen also ausgeschlossen. Ob in der Wiedergabe des Begriffs „Conni“ im Meme allerdings eine kennzeichenmäßige Verwendung zu sehen ist und ob die Werbefunktion der Marke im Hinblick auf die vom Verwender möglicherweise beworbenen Waren oder Dienstleistungen ausgenutzt wird, ist Frage des Einzelfalls.
Mögliche Folgen von Rechtsverletzungen
Unternehmen, die „Conni“-Memes unlizenziert als Werbemittel nutzen, riskieren also zumindest aus urheberrechtlichen Gesichtspunkten teure Abmahnungen, Unterlassungsklagen und Schadensersatzforderungen. Auch Beseitigungsansprüche mit negativer Öffentlichkeitswirkung und Reputationsverluste sind nicht zu unterschätzen. Ein Vorgehen gegen kommerzielle Nutzungen hat der Carlsen Verlag bereits per Pressemitteilung angekündigt.
Fazit
„Conni“-Memes sind ein viraler Trend mit kreativem Potenzial, aber auch mit erheblichen rechtlichen Risiken. Werbekampagnen sollten daher stets auch juristisch bewertet werden, um Haftungsfallen zu vermeiden.